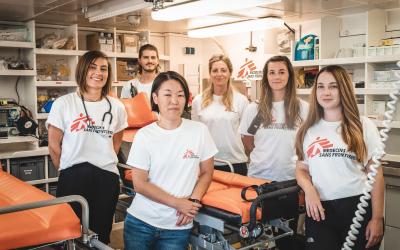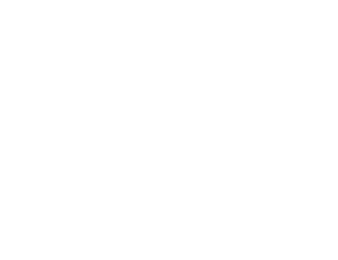Breadcrumb
Wie bist du zu Ärzte ohne Grenzen gekommen?
Schon als Kind wollte ich einmal für Ärzte ohne Grenzen arbeiten. Ich war 14 Jahre alt und habe ein Buch über den Krieg in Darfur, Sudan, entdeckt. Das war der Moment, wo ich in Kriegs- und Krisengebieten helfen wollte. Zuerst als Kinderärztin, weil ich gedacht habe, dass nur Ärzt:innen bei Ärzte ohne Grenzen arbeiten.
Aber das Buch eines Notfallmediziners hat das geändert: Er hat berichtet, wie wichtig der Zugang zu Trinkwasser und Sanitärversorgung ist. Denn viele Krankheiten entstehen durch verschmutztes Wasser. Also wollte ich Latrinen bauen, da haben alle den Kopf geschüttelt.

Ärzte ohne Grenzen kenne ich schon von klein auf, die Sichtbarkeit ist einfach da. Wenn man an humanitäre Hilfe denkt, fällt einem zuerst diese Organisation ein. Gerade weil wir in vielen Gebieten sind, wo andere Organisationen nicht mehr sind oder sein können. Ich bin dann 2020 zu Ärzte ohne Grenzen gekommen, als Projektkoordinatorin. Davor war ich schon mit anderen internationalen humanitären Organisationen unterwegs.
Wie war dein beruflicher Weg?
Ich habe Politikwissenschaften und Internationales Recht studiert. Deswegen ist für mich der Zugang zu basismedizinischer Versorgung ein Menschenrecht: Das ist untrennbar miteinander verbunden. Auch als Nicht-Medizinerin kann ich mich damit identifizieren.
In Österreich bin ich zuerst Projektkoordinatorin im Fluchtbereich gewesen. Dort habe ich ungefähr sechs Jahre lang gearbeitet. Mein Ziel war damals schon, später mit humanitären Organisationen und vor allem Ärzte ohne Grenzen auf Einsatz zu gehen.
Bei der ersten Bewerbung bei Ärzte ohne Grenzen hat es allerdings nicht geklappt, aber ich habe es wieder versucht – und nun bin ich schon seit vier Jahren dabei.
Was sind deine Aufgaben als Projektkoordinatorin?
Als Projektkoordinatorin bin ich dafür zuständig, dass alle Aktivitäten durchgeführt werden. Auch das Sicherheitsmanagement ist Teil meiner Aufgaben. Dazu gehören der Informationsaustausch, die Vernetzung sowie Vermittlung zwischen allen relevanten Akteur:innen.
So repräsentiere ich Ärzte ohne Grenzen bei allen externen Parteien wie zum Beispiel dem Gesundheitsministerium oder den Konfliktparteien. Das ist sehr wichtig, damit wir überhaupt in einem Land arbeiten können.
Ich kümmere mich auch um die ideale Zusammenarbeit unserer Teams: Die medizinische Teamleitung, Logistik und Administration wissen sehr gut, wie ihre Arbeit geht; ich kann als Projektkoordinatorin zwischen den verschiedenen Berufsdisziplinen zusätzlich vermitteln und die Kommunikation verbessern.
Ich muss auch immer den Überblick haben: Wenn wir mehr Betten in unserem Krankenhaus brauchen oder wenn es mehr Personal benötigt. In solchen Fällen unterstütze ich die Manager:innen.
Kannst du ein aktuelles Beispiel deiner Arbeit nennen?
Mein letzter Einsatz ging nach Gaza. Davor habe ich wochenlang überlegt und viele Gespräche mit Kolleg:innen von Ärzte ohne Grenzen, Familie und Freund:innen geführt. In Gaza ging es viel um die Sicherheit. Die Situation im Land hat großen Einfluss auf den Alltag und darauf, wie die Aktivitäten geplant werden.
Das heißt, man muss als Projektkoordinatorin einen Überblick über die verschiedenen Parteien haben und darüber, wie sich der jeweilige Konflikt entwickelt: So muss bei einer Evakuierungsanordnung oder einer Relokalisierung (Umsiedelung) vorher schon der Prozess klar sein. Diese Planung hat in Gaza sehr viel Zeit in Anspruch genommen: Wo verlagern wir unsere medizinischen Aktivitäten hin, wenn wir an einem Ort nicht bleiben können?

Auf welchen Einsätzen warst du bisher?
Mein erster Einsatz ging nach Libyen, dort bin ich elf Monate geblieben. Weil ich vorher schon im Bereich Migration und Flucht gearbeitet habe, hat das sehr gut gepasst.
Die Aufgaben als Projektkoordinatorin sind in Libyen nicht ganz typisch. Da geht es viel um den Schutz von Menschen und vor allem Geflüchteten: Wir haben damals in den Internierungslagern gearbeitet (Lager, wo Menschen ohne Gerichtsverfahren festgehalten werden). Wir haben dort basismedizinische Versorgung sowie psychomedizinische Unterstützung angeboten. Zielgruppe waren dabei besonders vulnerablen Gruppe wie zum Beispiel unbegleitete minderjährige Geflüchtete.
In Libyen hat das Aufbauen der Projekte lange gedauert, weil wir viel mit nicht-staatlichen bewaffneten Gruppen verhandeln mussten. Das ist wichtig um sicherzustellen, dass alle Akteur:innen wissen, wer wir sind und was wir machen. Nur so können wir in kritischen Kontexten arbeiten und die Sicherheit unserer Teams gewährleisten.

In Afghanistan warst du auch?
Genau. Danach war ich in Afghanistan in einem riesigen Krankenhaus, wo wir die Kinderabteilung geleitet haben. Auch die Triage, die Notaufnahme, Intensivstation und das therapeutische Ernährungszentrum waren dabei. Täglich sind hunderte mangelernährte Kinder zu uns in die Klinik gekommen.
Gegen Ende meines Einsatzes 2023 gab es dann die schweren Erdbeben in Herat. Da hat sich unser reguläres Projekt kurzfristig in einen Noteinsatz verwandelt. Trotz der Herausforderungen haben wir das im Team gut hinbekommen und rasch die Kinder auf der Intensivstation nach draußen evakuiert und gleichzeitig angefangen, Zelte aufzustellen um hunderte Verletzte zu versorgen.
Wie unterscheiden sich deine Einsätze?
Jeder Einsatz hat was Besonderes: Bei jedem lässt man etwas von sich zurück, und nimmt dafür wieder etwas mit. Das merkt man, wenn man nach Hause kommt: Dass ein kleines Stück von einem, einfach zurückgeblieben ist.
Bei Libyen hat es für mich absolut Sinn gemacht, dass wir dort sind, auch wenn es kein „klassischer Einsatztyp“ von uns ist. Und Gaza war einer der Einsätze, wo das subjektive Gefühl von Sicherheit so gar nicht vorhanden war.
In Afghanistan war eines meiner größten Projekte mit mehr als 500 lokalen Kolleg:innen und 18 internationalen Mitarbeiter:innen - und dann war plötzlich der Noteinsatz nach den Erdbeben, mit dem wir nicht gerechnet haben.
Ich denke, die Illusion die ganze Welt zu retten habe ich schon ziemlich früh aufgeben. Was wichtig ist, ist Dasein, wenn‘s drauf ankommt.
Was mich motiviert für Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten: Wir schauen hin und berichten darüber, was wir sehen, oft dort, wo niemand hinsieht – hinsehen will. Das nennen wir Témoignage: Diesen Kern von Ärzte ohne Grenzen schätze ich sehr. Denn wir wurden von Journalisten und Ärzten gemeinsam gegründet. Wenn es absolut perspektivenlos für die Menschen ist, so wie für die Menschen in Libyen oder Gaza, dann müssen wir das thematisieren.
Wie gehst du mit schwierigen Einsätzen um?
Was die größte Aufgabe ist, ist gegen die Entmenschlichung anzukämpfen. Das hatten alle meine bisherigen Einsätze gemeinsam: In Afghanistan werden Frauen ausgegrenzt und aus der Öffentlichkeit verbannt, und dann war diese extreme Gewalt gegen Menschen auf der Flucht in Libyen und intern vertriebene Menschen in Gaza.
In all dem Leid gibt es Menschen wie ich und du. Diese Menschlichkeit bewahre ich mir, wenn ich heimkomme.
Wichtig ist es, Gefühle zuzulassen. Gerade in Gaza war für Trauer keine Zeit, weil alles so schnell passiert ist. Traurig sein zu können, ist aber genauso wichtig wie Freude zu empfinden. Und ich muss auch so reflektiert sein, dass ich mir meiner Privilegien daheim bewusstwerden kann.
Wie findest du wieder zur Ruhe?
Irgendwann nach einem Einsatz, habe ich aufgehört zu vergleichen. Denn dann bin ich ja ständig frustriert. Wenn ich heimkomme, freue ich mich, dass ich wieder da bin. Dass ich meine Familie, meine Freund:innen und ihre Kinder wiedersehe.
Ich lebe in der Umgebung von Innsbruck und gehe auf den Berg. Manchmal passiert es mir dann schon, dass, wenn ich bei meiner Rückkehr aus dem Zug aussteige, intensive Gefühle in mir aufkommen.
Da erwische ich mich selbst dabei, wie ich an mir runtersehe und diese Erleichterung verspüre: Dass ich noch meine Beine und Arme habe, dass alles noch dran ist. Und dass auch die Berge in Innsbruck, noch genauso dastehen, wie ich sie zurückgelassen habe.
Was hilft dir noch?
Ich bespreche meine Einsätze im Rückblick mit einer Psychologin. Vor, während und nach einem Einsatz bietet auch Ärzte ohne Grenzen diese Betreuung an, das ist supergut.
Gleichzeitig habe ich eine Therapeutin, mit der ich über gewisse Entscheidungen spreche, die ich als Projektkoordination getroffen habe. Diese schaue ich mir mit mehr Abstand an, überlege, ob ich heute anders entscheiden würde. Das ist ein Lernprozess. Und es trägt dazu bei, dass ich mein Gleichgewicht wiederfinde.
Ich behalte auch meine Wohnung, die gebe ich nicht auf, auch wenn ich viel auf Einsätzen unterwegs bin. Mein Platz, meine Berge, mein Freundeskreis sind meine Erdung. Als Projektkoordinatorin hat man die Funktion, alles zusammenzuführen, zu koordinieren, dazu gehört auch die Emotionen vom Team zu begleiten. Aber zuhause ist mein Ruheort. Und dadurch, dass ich mir das so beibehalte, kann ich alle Erlebnisse gut integrieren – und mich auf meinen nächsten Einsatz freuen.