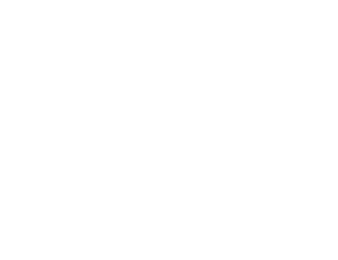Breadcrumb
Welt-Aids-Tag 1.12.: Erste Schritte, einen langen Weg zu verkürzen

In Lesotho, dem „Königreich im Himmel“, ist einer von fünf Erwachsenen HIV-positiv. Doch die Menschen haben kaum Zugang zu ärztlicher Versorgung und Medikamenten – sie sind zu weit weg. Nun liegt die Hoffnung auf der Einführung von HIV-Selbsthilfegruppen: Für eine verbesserte Gesundheitsversorgung durch mehr Verantwortung der Betroffenen. Unser Kollege Lee Butler berichtet von seinem Besuch in der Fatima-Klinik in der Bergregion des kleinen Staats, der ganz von Südafrika umgeben ist.
Auf einem Berghang mit einem beeindruckenden Blick über das Tal liegt die Fatima-Klinik, die von Ärzte ohne Grenzen unterstützt wird. Hier, tief im bergigen Lesotho, unterhalte ich mich mit Motseko Maknoae. „Ich bin zwei Tage lang zu Fuß hier her gegangen, übernachtet habe ich bei einem Verwandten. Ich muss diese Reise mindestens einmal pro Monat auf mich nehmen.“ Sie ist sehr viel vergnügter als ich es an ihrer Stelle wäre – und das, obwohl sie 74 Jahre alt ist und unter hohem Blutdruck leidet.
Doch das ist normal, wird mir gesagt. Es ist auch normal für Kranke, Schwangere oder jemanden, der nur seine Medikamente abholen muss. Ich bin 32 und bei guter Gesundheit, also sollte ich mich wohl nicht beschweren, dass mir mein Allerwertester noch immer von der zweistündigen Fahrt in einem klapprigen Auto wehtun, das mich hierher gebracht hat.
Einer von fünf Erwachsenen ist HIV-positiv
Das „Königreich im Himmel“, wie Lesotho auch genannt wird, ist ein entlegenes, bergiges Gebiet. Seine 1,8 Millionen Einwohner sind über das gesamte Land verteilt, die wenigen vereinzelten Straßen schlängen sich das steile Gelände entlang. Der Zugang zu Gesundheitsversorgung ist so eingeschränkt, dass sich Menschen erst gar nicht auf den Weg machen, wenn sie nicht wirklich krank sind. Dieser Umstand erschwert es besonders, gegen HIV vorzugehen – einer von fünf Erwachsenen ist HIV-positiv und benötigt daher lebenslang täglich Medikamente, um gesund zu bleiben. Alleine die Fatima-Klinik betreut täglich rund 50 Betroffene, von denen die meisten mindestens zwei Stunden zu Fuß unterwegs waren; viele auch länger.
Ich treffe Libuseng Marekimane, den Koordinator des Unterstützungsprogramms von Ärzte ohne Grenzen . Er hilft HIV-Patienten und -Patientinnen bei der Gründung von Selbsthilfegruppen. Die Idee dieser Gruppen besteht darin, dass die Mitglieder abwechselnd in die Klinik reisen und die Medikamente für alle Mitglieder abholen. Bei dieser Gelegenheit können sie auch gleichzeitig ihren Gesundheitsstatus überprüfen lassen. So haben Betroffene einen leichteren Zugang zu ihren antiretroviralen Medikamenten und werden dabei unterstützt, den Therapieplan lebenslang einzuhalten. Nur ein einziges Monat lang die Behandlung auszusetzen, kann verheerende Folgen haben – der Virus kann stärker werden und/oder eine Resistenz gegen die Medikamente entwickeln. Diese Initiative könnte ein Meilenstein sein im Kampf gegen HIV sein: Nicht nur, um Leben zu retten – derzeit werden rund 63% der Todesfälle in Lesotho auf HIV zurückgeführt – sondern auch, um die Stigmatisierung von Betroffenen zu verringern. HIV-positive Menschen werden mit dieser Strategie zu Partnern, statt nur als Empfänger von Gesundheitsdienstleitungen angesehen zu werden.
Betroffene unterstützen sich gegenseitig
Hier in Fatima besteht reges Interesse an diesen Selbsthilfegruppen: An nur einem einzigen Morgen traf ich jede Menge HIV-Patienten und –Patientinnen, die mitmachen wollen. So auch Mamatseliso Supu: „Ich bin heute früh um 6 Uhr aufgebrochen und musste vier Stunden lang zu Fuß hier her laufen – und das zwei Mal pro Monat.“ Für jeden einzelnen Betroffenen bedeuten Selbsthilfegruppen eine große Veränderung des täglichen Lebens: Nicht nur die Reisen in die Klinik werden weniger, sondern jedes Mitglied erhält auch Unterstützung von anderen Mitgliedern, die dasselbe Problem teilen – das Leben mit HIV. „HIV ist mit einem Stigma verbunden, besonders unter den Jungen. Ich denke es gibt viele Menschen, die antiretrovirale Medikamente nehmen, aber nicht wollen, dass es ihre Gemeinschaft erfährt“, fügt Mamatseliso hinzu. Wenn Nachbarn bemerken, dass jemand monatlich die Klinik aufsucht, ziehen sie wahrscheinlich einen unvermeidbaren Schluss: HIV. Doch es muss nicht zu dieser Schlussfolgerung kommen, wenn jemand nur zwei Mal jährlich dort hin reist. Ich unterhalte mich eine Weile mit Mamatseliso und mir wird klar, dass diese Gruppen den entscheidenden Unterschied machen können – nicht nur für sie, sondern für ganze Gemeinden.
Gesundheitsversorgung nahezu unerreichbar
In Lesotho sind die Krankenhäuser einfach zu weit weg von den Menschen. Doch wenn man sich die ökonomischen Ressourcen des Landes ansieht, wird es nicht möglich sein, einfach mehr Kliniken zu bauen. Deshalb schlug Ärzte ohne Grenzen das Modell der Selbsthilfegruppen als lebenswichtige Veränderung im Leben HIV-positiver Menschen in Lesotho vor. Die Strategie zeigt, dass es bei der Bereitstellung von Gesundheitsversorgung unter schwierigen Bedingungen nur einen einzigen konstanten Faktor gibt: Menschen, die den Zugang zu den Leistungen brauchen. Um diesen zentralen Punkt zu erfüllen, gibt es keine andere Wahl, als ihre Lebensrealität zu berücksichtigen und die Bereitstellung von Hilfe an ihre Bedürfnisse anzupassen – und nicht umgekehrt Betroffene zu zwingen, ihr Leben anzupassen.
Alle, mit denen ich mich unterhalten habe, sind stundenlang zu Fuß unterwegs gewesen – manche davon alt und kaum fähig, zu stehen, andere mit all ihren Habseligkeiten im Gepäck. Viele tragen mindestens ein Baby, so auch Matsietsi Mathabeng. Sie hält ihre einjährige Tochter mit den großen Augen im Arm und lässt mich kaum zu Wort kommen: „Ich bin zu Fuß hier her gegangen, mein Kind im Arm, weil ich mir kein Taxi leisten konnte (rund 40p, Anm.). Ich habe zwei Stunden gebraucht“, erzählt sie mir. „Es herrscht großer Bedarf an Einrichtungen wie dieser, und wir brauchen mehr davon in ganz Lesotho, weil viele Menschen entweder nicht gehen oder ein Taxi bezahlen können. Wenn das Wetter schlecht ist, werden sie noch kränker, während sie warten.“
Initiative nur mit Engagement der Menschen möglich
Meine letzte Begegnung mit Matsietsi macht mich traurig, doch dann werde ich inmitten dieser wundervollen Menschen daran erinnert, wie glücklich sie sind, dass diese Gesundheitseinrichtung überhaupt existiert. Ich bin überzeugt davon, dass diese Initiative im ganzen Land einen enorm positiven Effekt haben kann – in den Gemeinden, bei der Aufklärungsarbeit und der Veränderung von Vorstellungen. Ja, Ärzte ohne Grenzen spielt eine große Rolle, aber es wird sich nichts verbessern, bis die Betroffenen selbst mitmachen. Nach nur einem Tag hier in Fatima kann ich bestätigen, dass sie das wirklich wollen. Jetzt liegt der Ball bei den Verantwortlichen im Gesundheitsbereich und dass sie auf die Bedürfnisse der Menschen reagieren.
Das Community-Modell von Ärzte ohne Grenzen wurde erstmals im Jahr 2008 in der Provinz Tete in Mosambik eingeführt. Als Teil einer längerfristigen Strategie ähnlicher Gesundheitsmodelle zielt das System darauf ab, zwei der Haupthindernisse im Zugang zur Behandlung mit antiretroviralen Medikamenten abzubauen: Einerseits die Entfernung zu Gesundheitseinrichtungen und andererseits die mit der Reise verbundenen Kosten. Das wird möglich, indem die Patientinnen und Patienten einen Vorrat an Medikamenten für sechs Monate statt nur 30 Tage erhalten sowie durch den Zusammenschluss in größeren Gruppen sowohl in urbanen als auch in ländlichen Gebieten. Diese Modelle wurden stufenweise von mehreren Ländern im Süden Afrikas eingesetzt und erweisen sich als überaus erfolgreich, um Menschen bei der Einhaltung ihrer lebenslangen Therapie zu helfen. Die Einhaltung des Behandlungsplans ist der Schlüssel bei der Risikoreduktion einer HIV-Übertragung und der damit einhergehenden Entwicklung von Resistenzen gegen die erste Behandlungslinie mit antiretroviralen Medikamenten. In Tete sind nach vier Jahren mehr als 90% der 8.100 Mitglieder von Selbsthilfegruppen immer noch in Behandlung – im landesweiten Durchschnitt sind es nur 64% unter den Menschen mit einem ähnlichen Profil. Im Jahr 2012 wurde das Community-Modell von der mosambikanischen Regierung als Strategie für Menschen mit HIV empfohlen. Es wird derzeit in Lesotho eingeführt.
Details zum Community-Modell auf http://samumsf.org/blog/portfolio-item/cmc/