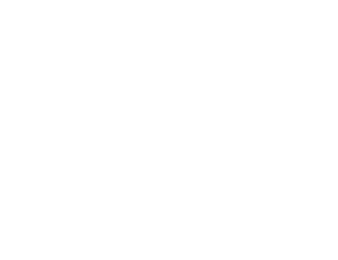Breadcrumb
„Die Menschen sehen keinen anderen Ausweg.”
Themengebiete:

Dr. Erna Rijnierse arbeitet für Ärzte ohne Grenzen auf dem Rettungsschiff MY Phoenix, das im Rahmen des gemeinsamen Rettungseinsatzes mit der Organisation MOAS im Mittelmeer zur Rettung von Bootsflüchtlingen unterwegs ist. Während das Schiff auf dem Weg in die Gewässer rund um die libysche Küste ist, erzählt die Ärztin vom ersten Rettungseinsatzes und den Lebensgeschichten der Geretteten.
"Bei unserem allerersten Rettungseinsatz standen die Menschen im Boot bereits bis zu ihren Fußknöcheln im Wasser. Nur wenige Stunden später wäre das Boot bereits gesunken und die Menschen darin ertrunken. Das ist der große Unterschied zwischen diesem Einsatz und meinen anderen Einsätzen mit Ärzte ohne Grenzen im Südsudan oder im Osten der Demokratischen Republik Kongo: Du weißt, dass diese Menschen mit Sicherheit sterben werden, wenn du sie nicht jetzt rettest.
Ein Notruf: Der Einsatz startet…
Die Rettungseinsätze werden von der italienischen Küstenwache koordiniert. Sie erhalten den Notruf, leiten ihn weiter und das nächstgelegene Rettungsschiff legt los. In diesem Fall waren es wir. Wir fuhren zur Stelle, wo sich das Flüchtlingsboot in Seenot befand. Unser Team, darunter eine medizinische Fachkraft, fuhr in einem kleineren Schlauchboot zu den Menschen.
Zuerst machen wir uns immer ein Bild der Situation: Wie ist die Lage? Wie viele Menschen sind an Bord? Sind darunter Kinder, kranke Menschen, Schwangere oder Verletzte?
Wir stießen auf ein Fischerboot aus Holz, auf dem sich 369 Menschen befanden. Niemand hatte Schwimmwesten und alle waren auf unglaublich engem Raum zusammengepfercht. Die Menschen waren so beengt, dass die meisten von ihnen bereits schwere Krämpfe in ihren Armen und Beinen hatten – eine Folge dessen, dass sie schon seit Stunden in derselben Position standen. Es gab schlichtweg keinen Platz, um sich hinzusetzen.

Wir verteilten Schwimmwesten an alle und brachten sie auf unserem Schlauchboot in kleinen Gruppen an Bord unseres Rettungsschiffes, der MY Phoenix.
Kleidung, Wasser und Nahrung für die Geretteten
Als ersten Schritt messen wir die Temperatur jedes einzelnen. Besonders verletzliche Gruppen wie ältere Menschen, Kranke, Frauen und Kinder werden auf das Unterdeck gebracht. Gesunde, starke Männer bleiben auf dem Oberdeck. Jeder erhält ein Rettungspaket mit einem Handtuch, einem Overall, um den Körper warm zu halten, zwei Flaschen Trinkwasser und eine Packung mit Energiekeksen. Wir geben auch trockene Kleider aus, falls jemand welche braucht. Natürlich haben wir an Bord auch gut ausgestattete Toiletten mit fließendem Wasser und Wascheinrichtungen.
Viele Menschen sind unterkühlt, doch zum Glück hatten wir bisher nur wenige in einem sehr schlechten Gesundheitszustand. Doch wir sind auf alles vorbereitet. Wir können Wiederbelebungsmaßnahmen starten, wir haben ein mechanisches Beatmungsgerät, Monitore und wir können Geburten sicher begleiten. Bei diesem ersten Rettungseinsatz hatten wir acht Schwangere an Bord. Eine davon war bereits im achten Monat und spürte, wie sich das Kind die ganze Nacht lang bewegte. Ich war die ganze Zeit bereit – doch das Baby nicht. Vielleicht war das auch das Beste so.
Verzweiflung zwingt Menschen, das Risiko einzugehen
Es sind nicht nur junge Männer, die diese gefährliche Route auf sich nehmen. Die Bootsflüchtlinge sind aus allen Altersgruppen und stammen aus verschiedenen Teilen der Welt. Es gibt Schwangere, ältere Menschen – sogar Familien mit kleinen Kindern. Das sagt sehr viel aus über den Gemütszustand, der die Menschen dazu bringt, so ein Boot zu besteigen. Wenn du ein Elternpaar mit zwei kleinen Kindern bist, und du besteigst in vollem Bewusstsein der Risiken ein marodes Holzboot – dann bist zu wahrhaftig verzweifelt. Und sie sind es auch. Sie sehen keinen anderen Ausweg, um wo sicher Zuflucht oder ein besseres Leben zu finden.
Ich habe Menschen mit alten Verletzungen gesehen und solche, denen die Zähne ausgeschlagen wurden. Jeder hat eine Geschichte – so wie all die Menschen, denen ich im Südsudan oder in der Zentralafrikanischen Republik geholfen habe. Doch vielleicht sind die Geschichten der Menschen auf den Booten sogar noch schrecklicher. In ihren Heimatländern waren sie Krieg, Gewalt oder dem völligen Verlust von Freiheit und Gerechtigkeit ausgesetzt.
Die Flüchtenden lassen alles und jeden hinter sich
Ich habe mit einer Familie aus Syrien gesprochen. Mit einer Gruppe von Teenagern aus Somalia. Mit zwei jungen Brüdern aus Nigeria. Mit einem jungen Mann aus Eritrea, der in seinem Heimatland genau eine Wahl hatte: Lebenslanger Militärdienst oder Gefängnis. Alles, was diese Menschen wussten, läuft darauf hinaus: Zu bleiben ist schlichtweg keine Option. Sie würden eher sterben, als zu bleiben.
Die Leute sprechen über diese Flüchtlinge, als ob sie nichts anderes währen als opportunistische Glücksjäger. Doch diese Bootsflüchtlinge denken nicht müßig daran, das Mittelmeer zu überqueren. Es ist rein gar nichts opportunistisches daran, alles und jeden hinter sich zu lassen.
Es ist meine Pflicht, zu helfen.
Kann man einfach nur danebenstehen und zusehen, wie sie auf dem Weg in ihre Freiheit ertrinken? Wir können das nicht. Sollten wir von Ärzte ohne Grenzen überhaupt draußen auf dem Meer sein und Menschen retten? Manche Leute sagen, wir sollten das nicht. Und vielleicht haben sie auch Recht. Aber solange Menschen auf hoher See leiden, haben wir guten Grund dazu, hier zu sein. Als Ärztin und als humanitäre Helferin ist es meine Pflicht.
Viele der 369 Menschen, die wir bei diesem ersten Einsatz gerettet haben, erzählen mir, dass sie sich hier erstmals seit langer Zeit sicher genug fühlten, um nachts zu schlafen. Für viele war es das erste Mal seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren, dass sie einen Arzt zu Gesicht bekamen.
An Land wartet eine unsichere Zukunft
Nach unserem ersten Einsatz brachten wir die geretteten Menschen nach Pozzallo an der sizilianischen Küste, wo sie von den italienischen Behörden aufgenommen und ihre Fälle bearbeitet werden. Sobald die Flüchtlinge einen Fuß an Land setzen, blicken sie einer unsicheren Zukunft entgegen.
In dem Moment, in dem sie auf hoher See gerettet werden, sind sie extrem glücklich und dankbar. Die Menschen schütteln deine Hand oder wollen dich auf die Wange küssen. Doch je näher man zur Küste kommt, desto leiser werden sie. Sie haben furchtbare Dinge durchgemacht. Und ihre Reise ist noch lange nicht vorbei.
Und ich?
Ich liebte das Meer. Doch jetzt werde ich es nie mehr auf dieselbe Art und Weise betrachten können."