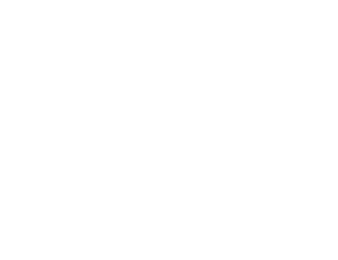Breadcrumb
Wenn man Kranke wegschicken muss - Ebola-Nothilfe in Liberia

Pierre Trbovic, ein Anthropologe aus Belgien, ist seit Ende August für Ärzte ohne Grenzen in der liberianischen Hauptstadt Monrovia tätig. Das dortige Ebola-Behandlungszentrum ist völlig überfüllt und das Personal überfordert, doch weitere Kranke stehen Schlange, um aufgenommen zu werden. Pierre übernahm deshalb die herzzerreißende Aufgabe, Menschen wegzuschicken.
"Gleich nach meiner Ankunft in Monrovia war mir klar, dass meine Kollegen und Kolleginnen vom Ausmaß der Ebola-Epidemie überfordert waren. Unser Behandlungszentrum – das größte, das Ärzte ohne Grenzen je aufgebaut hat – war voll, und unser Projektkoordinator Stefan stand am Eingang und schickte Leute weg, weil es keinen Platz mehr gab. Bei einem Noteinsatz muss man flexibel sein; dies war keine Aufgabe, die wir eingeplant hatten, aber jemand musste sie übernehmen. Also meldete ich mich freiwillig.
Während der ersten drei Tage, die ich am Eingang stand, regnete es in Strömen. Die Menschen waren durchnässt, aber sie warteten weiter. Sie konnten sonst ja nirgendwo hin.
Der erste, den ich wegschicken musste, war ein Vater, der seine kranke Tochter im Kofferraum seines Autos zu uns brachte. Er war ein gebildeter Mann, und er flehte mich an, seine jugendliche Tochter aufzunehmen. Ihm sei klar, dass wir ihr Leben nicht retten könnten, sagte er. Doch wenigstens sollten wir den Rest der Familie vor einer Ansteckung beschützen. Da musste ich hinter eines unserer Zelte gehen, um zu weinen. Ich schämte mich nicht für meine Tränen; ich wusste aber, dass ich für meine Kollegen stark bleiben musste. Wenn wir alle zu weinen anfangen würden, wäre alles nur noch schwieriger.
Andere Familien kamen mit ihren Autos, ließen die Kranken aussteigen und fuhren gleich wieder davon. Eine Mutter versuchte, ihr Baby auf einen Stuhl zu setzen und dann zu gehen, in der Hoffnung, dass wir uns dann um ihr Kind kümmern müssten.
Ich musste auch ein Paar abweisen, das seine junge Tochter zu uns brachte. Das Mädchen starb zwei Stunden später, vor dem Eingang. Sie blieb dort liegen, bis das Leichen-Entsorgungsteam sie abholte. Regelmäßig brachten Rettungswagen Ebola-Verdachtsfälle aus anderen Gesundheitseinrichtungen zu uns, aber wir konnten nichts unternehmen. Wir konnten sie auch sonst nirgendwo hinschicken – alles war überfüllt und ist es noch immer.
Nachdem ich erstmals die Hochrisikozone betreten hatte, verstand ich, warum wir keine Patienten mehr aufnehmen konnten: Alle waren vollkommen überlastet. In einem Ebola-Behandlungszentrum müssen bestimmte Maßnahmen und Abläufe eingehalten werden, um die Sicherheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu gewährleisten. Wenn die Menschen keine Zeit haben, diese zu befolgen, beginnen sie, Fehler zu machen.
Es kann bis zu 15 Minuten dauern, bis die Mitarbeiter den Schutzanzug richtig angelegt haben, und in der Hochrisikozone können sie sich damit auch nur eine Stunde aufhalten. Danach sind sie erschöpft und völlig verschwitzt. Bleiben sie länger, wird es gefährlich. Den Patienten geht es sehr schlecht, und es ist viel Arbeit, die Behandlungszelte sauber zu halten. Exkremente, Blut und Erbrochenes muss beseitigt und die Leichen abtransportiert werden. Es ist absolut unmöglich, noch mehr Patienten aufzunehmen, ohne die Mitarbeiter und unsere Arbeit zu gefährden. Aber dies den Menschen zu erklären, die uns anflehen, ihre Angehörigen aufzunehmen, ist fast unmöglich. Auch wenn wir ihnen sagen, dass wir das Behandlungszentrum so schnell wie möglich vergrößern. Alles, was wir tun können, ist, den Menschen Schutzpakete mit Handschuhen, Kitteln und Masken mit nach Hause zu geben, damit das Ansteckungsrisiko geringer ist, wenn sie ihre Angehörigen betreuen.
Nach dem Regen kam die sengende Hitze. An einem Tag wartete ein alter Mann fünf Stunden vor dem Behandlungszentrum. Ein kaputter Schirm war sein einziger Schutz vor der Sonne. Während all der Zeit war das einzige, was er zu mir sagte: „zu viel Sonne“. Es war sehr anstrengend für ihn. Sein Sohn war bei ihm, doch er hatte Angst, ihm zu nahe zu kommen und ihn zu trösten. Als wir ihn endlich aufnehmen konnten, kam sein Sohn zu mir und dankte mir mit Tränen in den Augen.
Während meiner Zeit am Eingang kamen auch andere Menschen zu uns, die nicht krank waren. Aus Angst, Ebola zu haben, konnten sie nicht mehr schlafen und essen – sie wollten nur einen Test. Aber wenn wir Sterbende abweisen müssen, wie können wir dann gesunde Menschen aufnehmen? Wieder andere kamen, weil sie unbedingt Arbeit wollten und bereit waren, alles zu tun, auch wenn es das Abtransportieren von Leichen war.
Als die Krankenschwestern, die ich sehr bewundere, begannen Mitleid mit mir zu haben und mir sagten, dass sie meine Arbeit nicht machen könnten, wurde mir klar, dass es doch härter war als gedacht. Nach einer Woche sagten mir die anderen, ich müsse damit aufhören. Sie sahen die psychischen Auswirkungen, die diese Arbeit auf mich hatte.
Am selben Nachmittag kam ein Kollege zu mir und sagte, er müsse mir etwas zeigen. Wenn Ebola-Patienten wieder gesund werden, wird eine kleine Feier für sie organisiert. Das wollte mir der Kollege zeigen: Ich sah, wie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zusammenkamen, um diesen außergewöhnlichen Moment zu feiern, und ich hörte die Worte der entlassenen Patienten, die uns dankten. Sie sind der Grund, warum wir hier sind. All meine Kollegen hatten Tränen in den Augen. Manchmal gibt es auch einen guten Grund, um zu weinen."