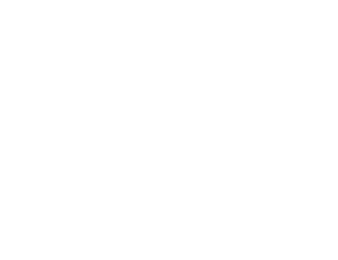Breadcrumb
Syrien: „Viele Krankenhäuser sind verwüstet“
Themengebiet:

Fabrice Weissman, Vordenker von Ärzte ohne Grenzen, über die aktuelle Lage in Syrien, die ungleiche Verteilung der internationalen Hilfe und die Probleme „humanitärer Interventionen“. (Interview aus "Die Presse")
Was ist das größte Problem bei der humanitären Hilfe in Syrien?
Fabrice Weissman: Der Großteil der internationalen Hilfe geht über Syriens Hauptstadt, Damaskus. Alle Organisationen, die via Damaskus aktiv sind, sind in ihrer Möglichkeit, bestimmte Gebiete zu erreichen, eingeschränkt. Das Flüchtlingshochkommissariat UNHCR etwa muss Zelte und Decken zunächst nach Latakia fliegen, das von der Regierung kontrolliert wird. Dann muss es einen Straßenkonvoi organisieren, um sie in eine Region zu bringen, die von der Türkei aus leicht zugänglich wäre.
Warum dieser Umweg?
Weissman: Syriens Regierung will keine Hilfe über die Grenze hinweg in ein Gebiet, das sie nicht kontrolliert. Ich verstehe trotzdem nicht, warum die internationale Gemeinschaft bisher so zurückhaltend ist mit massiver Hilfe für die Grenzregion.
Wie arbeitet Ärzte ohne Grenzen?
Weissman: Wir erhalten keinen Zugang zu Gebieten, die von der Regierung kontrolliert werden. Wir können nur dem Teil der Bevölkerung helfen, der unter Kontrolle der Rebellen lebt. Unsere Einrichtungen liegen nahe der türkischen Grenze. Wir versuchen nun auch Enklaven zu erreichen, die im Rebellengebiet liegen, aber von Regime-Getreuen kontrolliert werden. Damit testen wir auch die Bereitschaft der Opposition, ob sie uns das machen lässt, was uns die Regierung verweigert: die Front zu überschreiten, um dem „Feind" zu helfen.
Worunter leiden die Menschen am meisten?
Weissman: Die Zahl der Verwundeten hat sich dramatisch erhöht. Vor allem Kämpfer haben Schusswunden, Zivilisten Wunden durch Artillerie und Luftangriffe. Menschen mit chronischen Krankheiten geraten in große Schwierigkeiten - etwa Dialysepatienten oder Krebspatienten, die keine Chemotherapie mehr erhalten. Viele Krankenhäuser sind wegen der Bombardements verwüstet. Ich habe eines dieser Spitäler besucht. Es war leer, abgesehen von der Dialyseabteilung. Doch die speziellen Dialysekits wie Filter gehen aus.
Während des Bosnien-Krieges hat Ärzte ohne Grenzen Militärschläge gegen serbische Truppen gefordert. Warum tut MSF das nicht bei Syrien?
Weissman: In den Neunzigerjahren, vor allem während der Jugoslawien-Kriege, waren wir sehr interventionistisch. Wir hatten die Utopie, dass westliche Demokratien gemeinsam mit multilateralen Institutionen eine größere Rolle im Konfliktmanagement spielen könnten - indem sie etwa NGOs den Zugang zu Menschen ermöglichen, die Hilfe benötigen. Aber das hielt der Realität nicht stand. In Somalia endete die Intervention damit, dass UN-Truppen im Namen humanitärer Prinzipien auf Zivilisten schossen.
Derartige Aufrufe von Ärzte ohne Grenzen kamen aber auch später: Ich war 2009 im Kongo, wo Joseph Konys „Lord's Resistance Army" Massaker verübte. Und die dortige MSF-Mission forderte von der UN-Truppe, die Bevölkerung zu schützen.
Weissman: Das führte auch zu großen Diskussionen innerhalb von MSF. Die Erwartung, dass die UNO alle Dörfer vor den Angriffen der Lord's Resistance Army schützen könnte, war ohnehin illusorisch.
Aber wo ist der Unterschied zu Syrien?
Weissman: Kosovo und Libyen zeigten, dass Interventionen nicht Recht, sondern mit Gewalt eine neue politische Ordnung brachten. Es gab Sieger, Verlierer und viele Tote. Jetzt besteht eine starke Position innerhalb von MSF, keine Militärinterventionen im Namen humanitärer Prinzipien zu unterstützen. Natürlich gibt es immer Ausnahmen: etwa die Völkermorde wie in Ruanda 1994, als wir zum ersten Mal zu einer Militäroffensive aufgerufen haben. Aber trotz der verheerenden Lage kann man Syrien heute nicht mit Ruanda vergleichen.
Die UNO versucht Beweise, für Kriegsverbrechen in Syrien zu sammeln, um sie dem Internationalen Strafgerichtshof vorzulegen. Dabei will man sich auch auf Informationen humanitärer Organisationen wie MSF stützen. Könnte das Ihre neutrale Position gefährden?
Weissman: Neutral zu sein, bedeutet für uns zwei Dinge. Erstens: Nicht zu entscheiden, wer Recht hat und wer nicht. Wir unterstützen also in Syrien weder die Rebellen noch die Regierung. Zweitens: Wir wollen nicht in die militärischen Auseinandersetzungen hineingezogen werden. Es ist nicht unser Job, Beweise für den Internationalen Strafgerichtshof zu sammeln. Unsere offiziellen Statements kann aber jeder verwenden: auch der Strafgerichtshof.
Neutral zu sein und Zugang zu den Menschen zu erhalten, die Hilfe brauchen, bedeutet auch, mit „den Bösen" zu sprechen.
Weissman: Wenn die „Bösen" die sind, die von westlichen Regierungen als Terroristen bezeichnet werden, sage ich: Ja, wir müssen auch mit denen reden, ob jetzt in Mali oder in Afghanistan, wo wir auch mit den Taliban oder anderen aufständischen Gruppen zu tun haben. Das wurde von westlichen Staaten bisher toleriert. Wir gehen mit diesen Gruppen so um, wie mit allen anderen - etwa mit den Regierungen in Konfliktzonen. Wir versuchen, eine Übereinkunft zu erzielen, wie wir den Bedürftigen dort helfen können und wie wir zugleich die Steuern, die wir entrichten müssen, so niedrig wie möglich halten können. Oft muss man etwa Abgaben leisten für Fahrzeuge, die man einführt - entweder an Regierungen oder eben an bewaffnete Gruppen. Wir schauen uns an, wie ein Kompromiss aussieht - ob er mehr der betroffenen Bevölkerung oder den jeweiligen Herrschenden hilft. Danach wägen wir ab, ob wir den Einsatz unter diesen Umständen durchführen. Ich denke auch in Syrien wäre die Regierung froh, wenn wir Geld und Medikamente einfach nach Damaskus bringen würden. Aber das reicht uns nicht.
Sie haben Afghanistan angesprochen. Dort wird ein großer Teil der humanitären Hilfe von den internationalen Truppen geleistet. Was denken Sie darüber?
Weissman: Militärische Organisationen haben die politische Verantwortung, in dem Gebiet, das sie kontrollieren, der Bevölkerung Hilfe zu leisten. Meist machen sie das natürlich gemäß ihren eigenen Prioritäten, die von militärischen Notwendigkeiten diktiert werden. Wir sehen kein Problem, so lange uns die jeweilige Armee unabhängig arbeiten lässt, gemäß unserer eigenen Prioritäten. Manchmal versuchen sie aber, die Aktivitäten von Hilfsorganisationen zu „organisieren". Gegen das wenden wir uns.
Gerade in Afghanistan ist humanitäre Hilfe durch Streitkräfte aber auch Teil der psychologischen Kriegsführung. Man belohnt etwa ein Dorf, das im Kampf gegen die Aufständischen kooperiert. Ist das nicht ein Problem?
Weissman: Deshalb braucht es ja auch humanitäre Organisationen, die andere Prioritäten haben.
Die humanitäre Hilfe des Militärs birgt die Gefahr in sich, dass etwa in Afghanistan bewaffnete Gruppen die unabhängigen Helfer mit den internationalen Truppen in einen Topf werfen. Ist das ein Sicherheitsproblem für Organisationen wie MSF oder das Rote Kreuz?
Weissman: Wenn die Armee klar als Armee operiert und die Soldaten ihre Uniformen tragen, ist das kein großes Problem. Es wird dann zum Problem, wenn Soldaten etwa in weißen Fahrzeugen unterwegs sind, die auch internationale Hilfsorganisationen benutzen, oder wenn sie ähnliche Abzeichen verwenden. Damit solche Dinge nicht verwechselt werden, haben wir in Afghanistan Kommunikationskanäle zu den Aufständischen. So lange die andere Seite weiß, was du tust und was du auch für sie tust, ist das kein Problem. Die Aufständischen in Afghanistan sehen uns heute auch anders als früher. 2004 wurden fünf unserer Mitarbeiter umgebracht. Die Taliban haben dafür die Verantwortung übernommen, obwohl sie es eigentlich gar nicht waren. Zu dieser Zeit verfolgten die Taliban die Strategie, Afghanistan ins Chaos zu stürzen und jeden Wiederaufbau zu verhindern. Deshalb waren wir für sie tot wertvoller als lebendig. Das änderte sich, nachdem die Taliban die Kontrolle über ein größeres Territorium übernommen hatten. Damit rutschten sie in die Rolle einer Verwaltungsbehörde und mussten auch für die von ihnen beherrschte Bevölkerung eine gewisse Verantwortung übernehmen. Deshalb sind wir jetzt für sie lebendig wertvoller als tot.
Das Interview führte Wieland Schneider, der Originaltext ist am 25.03.2013 in der Presse Online erschienen.