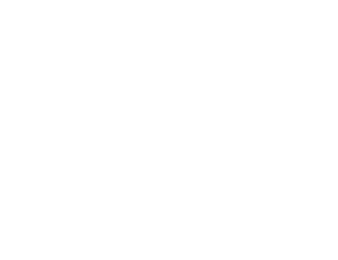Breadcrumb
Ein Chirurg in Syrien: “Schlaf und Erholung waren ein unleistbarer Luxus.”

Ärzte ohne Grenzen betreibt derzeit sechs Gesundheitszentren im Norden Syriens – doch im Großteil des Landes können unsere Teams nicht direkt vor Ort medizinische Hilfe leisten. Damit inmitten des Krieges trotzdem eine grundlegende medizinische Versorgung aufrechterhalten werden kann, unterstützten wir über 100 medizinische Einrichtungen in Syrien. Die Einrichtungen befinden sich dort, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird – in belagerten Regionen und aktiven Konfliktgebieten, wo es ansonsten kaum oder gar keine medizinischen Leistungen gibt.
Dr. S. ist ein junger Chirurg, der kurz nach Ausbruch der Krise in Syrien sein Studium abschloss. Er arbeitet in einem Behelfskrankenhaus im Osten von Damaskus. Ärzte ohne Grenzen unterstützte diese Einrichtung während der Belagerung und lieferte monatlich Material und Medikamente – bis heute. Die Erlebnisse und medizinischen Erfahrungen von Dr. S. zeichnen die Entwicklung des Krieges in Syrien nach.
„Eine hochschwangere Frau war während der Belagerung eingeschlossen – die Niederkunft stand kurz bevor. Alle Verhandlungsversuche, sie herauszubekommen, scheiterten. Sie benötigte einen Kaiserschnitt, doch es gab keine Entbindungsklinik, wo wir sie hinbringen konnten. Ich hatte noch nie eine solche Operation durchgeführt.
Wenige Tage vor dem Geburtstermin versuchte ich, eine funktionierende Internetverbindung herzustellen, um mich über Kaiserschnitte zu informieren. Die Uhr tickte und meine Angst und Anspannung stiegen. Ich wünschte, die Zeit anhalten zu können – doch dann setzten die Wehen ein. Die Stimmung war ohnehin bereits angespannt, denn wir standen unter massivem Raketenbeschuss. Die Bombardements waren ohrenbetäubend. Wir brachten die Frau in den Operationssaal und ich führte den Eingriff durch. Ich war überwältigt vor Freude als wir sahen, dass sowohl das neugeborene Mädchen als auch seine Mutter gesund und munter waren.
So viele Leben wie möglich retten
In all diesem Wahnsinn ist es unsere Aufgabe als Chirurgen, so viele Leben wie möglich zu retten. Manchmal gelingt es uns, und manchmal versagen wir. Wir reparieren den Schaden, den der Krieg anrichtet. Doch diese Operation war nicht die übliche Schadensbeseitigung – wir brachten neues Leben auf diese Erde. Es war ein magischer Moment; ein Augenblick der Waffenruhe, den selbst der Tod nicht stören konnte.
Ich schloss meine Ausbildung zum Chirurgen ab, kurz nachdem die Krise in Syrien losging. Im Sommer 2011 begann ich, in kleinen Privatkliniken zu arbeiten – die Vorfälle überschlugen sich zu dieser Zeit, und der medizinische Bedarf nahm laufend zu. Wenige Monate später wurde ich verhaftet, so wie viele meiner Kollegen. Anfang 2012 wurde ich wieder freigelassen, daraufhin behandelte ich wieder Menschen und vertiefte meine chirurgische Spezialisierung. Ich arbeitete in improvisierten Feldspitälern und operierte unter Bedingungen, die für die medizinische Arbeit meistens völlig unzulänglich waren. Wir arbeiteten im Osten von Damaskus und dann in der Gegend von Ghouta, wo die medizinischen Bedürfnisse am dringlichsten waren.
Ende 2012 kam es in einer fast ländlichen Gegend im Osten von Damaskus zu gewaltsamen Zusammenstößen. Das Gebiet war dicht befüllt mit Vertriebenen – doch es gab kein einziges Gesundheitszentrum, wo Verwundete versorgt werden konnten. Ich fuhr dorthin und entschloss, ein Feldspital aufzubauen. Nach meiner Suche entschied ich mich für eine verlassene Schule, die getroffen worden war. Die oberen Stockwerke waren zerstört, doch das Erdgeschoss und der Keller waren noch in einem guten Zustand. Trotz der täglichen, anhaltenden Bombardements und ständiger Angst schaffte es unser medizinisches Team, enorme Hilfe für diejenigen zu leisten, die sie am dringendsten benötigten.
Die Belagerung: Es regnete Bomben
Eines Tages im Juli 2013, ungefähr um 10 Uhr vormittags, wurde das Krankenhaus von einer Rakete getroffen. Die schwere Explosion stellte alles auf den Kopf, der Druck riss die Holzwände nieder. Menschen und medizinische Geräte wurden in alle Richtungen geschleudert. Kurz darauf senkte sich eine Staubwolke auf das Gebäude, man konnte nichts mehr sehen. Wir hatten noch nie eine solche Explosion erlebt. Ich konnte nur daran denken, dass es schlimmer werden könnte und diese Detonation nur der Anfang von etwas Furchtbarem sein könnte. Und tatsächlich regnete es daraufhin in unserer Gegend Bomben. Wir hörten, wie die Kämpfe immer schwerer wurden.
Als wir uns langsam vom Schock erholten, brach eine unserer Mitarbeiterinnen im Krankenhaus zusammen. Sie lebte in der Nähe der Klinik. Ihr kleiner Junge war zu dieser Zeit Zuhause; das Gebiet wurde schwer bombardiert. Sie konnte nicht mehr ruhig bleiben und wollte ihr Kind retten. Ein Sanitäter bot ihr an, hinaus zu gehen und nach ihrem Kind zu suchen. Ich war von der Idee nicht sehr überzeugt, da wir nicht wussten, was draußen vor sich ging. Sobald er aus der Tür des Krankenhauses trat, stand er einem Panzer mit einer Kanone gegenüber. Ein gesunder Mann ging hinaus, und wenige Momente später kam er mit lauter Metallscherben in seinem Körper zurück. An diesem Punkt realisierten wir die Sicherheitslage. Wir entschieden, das Krankenhaus zu evakuieren – zwei aus unserem medizinischen Team trugen je einen Patienten – und verließen das Gebäude durch die Hintertüre.
Schlaf und Erholung waren ein unleistbarer Luxus
Es war die Apokalypse! Wir versuchten zu einem kleinen medizinischen Zentrum in der Nähe zu gelangen. Die Bomben schlugen um uns in die Felder ein. Ich ging bei jeder Bombe, die wir hörten, vom Schlimmsten aus. Wir schafften es, unser Ziel unbeschadet zu erreichen. Es war wie ein Wunder. Wir hatten unsere Ausrüstung im evakuierten Spital gelassen, doch trauten uns nicht, dorthin zurück zu gehen. In den nächsten Tagen hörten wir, wie sich die Kämpfe vom Gebiet des Krankenhauses wegbewegten. Unter schwerem Beschuss entschlossen wir uns dazu, zurück zu gehen, um unsere Ausrüstung zu holen. Wir mussten es tun, um die Menschen weiter behandeln zu können. Wir wechselten uns immer wieder ab und holten innerhalb von zehn Tagen so viel wie möglich.
Von diesem Zeitpunkt an waren wir unter Belagerung – es war unmöglich, hinein oder hinaus zu kommen. Das galt auch für medizinische Bedarfsmittel. Ab dem ersten Tag der Belagerung strömten laufend Verwundete zu uns. Ich operierte oft zwei Menschen auf einmal. Wir arbeiteten rund um die Uhr. Schlaf und Erholung waren ein unleistbarer Luxus. Wir schafften kurz vor der Morgendämmerung, eine Pause einzulegen, um zu essen und Wasser zu trinken – dann gingen wir zurück an die Arbeit. An den meisten Tagen kamen aufgrund des anhaltenden Bombardements und der schweren Kämpfe mehr und mehr Verletzte zu uns; wir hatten keine Chance, uns auszuruhen. Die Zahl der Verwundeten lag weit über unserem Kapazitätslimit, deshalb waren wir gezwungen, sehr schmerzhafte medizinische Entscheidungen zu treffen.
Nach Belagerung bleibt humanitäre Situation katastrophal
Wir wurden acht Monate lang belagert – bis Februar 2014. Acht Monate Leid und Anspannung, gefolgt von einem Waffenstillstand, während dem viele Menschen endlich nach Hause zurückkehren konnten. Es wurde einfacher, an Material und Medikamente zu kommen, so konnten wir weiter Menschen in Not medizinisch versorgen. Doch die humanitäre Situation blieb katastrophal. Es gab weiterhin oft Kämpfe am Rand dieser Region und es kam weiterhin häufig zu Bombardements. Der formelle Waffenstillstand änderte nichts an unserer Arbeit, doch wir hatten endlich etwas Zeit, um das Krankenhaus auszubauen. Je mehr Menschen zurück in diese Nachbarschaft kamen, desto größer wurde der Bedarf – und damit stieg auch der Druck. Wir bauten eine Geburtshilfestation und eröffneten Zentren, wo medizinische Grundversorgung geleistet und chronische Krankheiten behandelt werden konnten.
Wir konnten endlich auch Knochenchirurgie sowie interne Eingriffe anbieten. All diese Operationen konnten wir davor nicht durchführen, da wir unter kritischen Engpässen bei Materialien und Medikamenten litten. Wir mussten daher die Priorität auf lebensrettende Operationen legen.
Ärzte ohne Grenzen unterstützte uns weiterhin mit dem meisten, das wir benötigten. Wir erhielten sogar ein Labor-Kit, mit dem wir diagnostische Tests durchführen konnten. Und wir bekamen einen Inkubator für die Geburtshilfe. Nach und nach konnten wir endlich auch auf die medizinischen Grundbedürfnisse der Menschen in diesem Gebiet eingehen.
Es muss eines Tages aufhören
Drei Jahre Non-Stop-Chirurgie unter sehr schwierigen Bedingungen – ich habe mein Limit ausgereizt. Ich hatte genug Erfahrungen von Leid und Elend. Ich habe kürzlich mit meinem Chirurgie-Professor telefoniert, er sagte: „In diesen drei Jahren hast du all die Erfahrungen gesammelt, die ich in meiner 30-jährigen Karriere als Arzt gemacht habe – unabhängig von den Umständen, unter denen du operiert hast. Du hast also in nur drei Jahren den Ruhestand erreicht.“
Und ich habe tatsächlich genug – jeden Moment jedes einzelnen Tages. Doch wir haben keine Wahl, wir müssen weitermachen. Die Menschen hier brauchen uns. Sie sind verzweifelt und benötigen alle Arten medizinischer Hilfe, von der einfachsten bis zur kompliziertesten. Wir dürfen kein Grund sein, dass sich diese ohnehin schon desaströse Situation weiter verschlechtert.
Heute bin ich mir fast sicher, dass ich mit der Medizin aufhören werde, sobald der Krieg aus ist. Jedes menschliche Wesen würde diese Entscheidung treffen, wenn man einmal durchgemacht hat, was ich erlebt habe. Ich hoffe auf das Ende dieses Krieges. Es muss eines Tages aufhören. Dann kann ich mich frei entscheiden, was ich tun möchte. Erst dann werden wir wieder wirklich lebendig sein.
Mehr erfahren: "Arbeiten im Untergrund: Unterstützung für syrische ÄrztInnen in Konfliktgebieten"