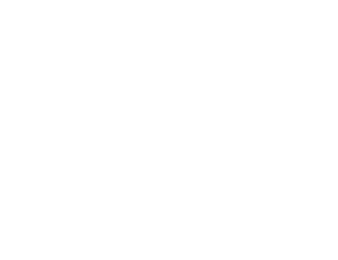Breadcrumb
Ebola: “Die Kranken vertrauen mir mehr als dem Pflegepersonal“

In Conakry arbeitet Ärzte ohne Grenzen mit ehemaligen PatientInnen zusammen, die eine Ebola-Infektion überlebt haben. Sie sollen die Bevölkerung über die Krankheit aufklären und die Erkrankten moralisch unterstützen. Im Kampf gegen die Krankheit sind diese neuen HelferInnen von unschätzbarem Wert, weil sie der lebende Beweis dafür sind, dass eine Heilung möglich ist.
Als Safiatou* im März 2014 ins Ebola-Behandlungszentrum in Conakry eingewiesen wurde, hatte sie Fieber und starke Kopfschmerzen. Nach und nach folgten ihr sechs weitere Familienmitglieder, alle mit demselben geheimnisvollen und verheerenden Virus infiziert.
Die Familie Keita ist sehr wahrscheinlich die erste, die sich in Conakry mit Ebola angesteckt hat: Ein erkrankter Onkel, der bei ihnen zu Besuch war, hatte das Virus eingeschleppt. Mohammed, ein Cousin von Safiatou, der jetzt gemeinsam mit ihr PatientInnen betreut, erzählt: "Auf der Isolierstation habe ich von Ärzte ohne Grenzen -MitarbeiterInnen ein Radio bekommen, so dass ich Nachrichten hören konnte. Ich erfuhr, dass die Krankheit Conakry erreicht hatte, und da begriff ich, dass wir Ebola hatten. Aber ich wollte es Safiatou und meiner Frau nicht erzählen. Ich dachte, das wäre zu viel für sie."
"Ich wusste nur, dass ich hier wieder lebend hinaus wollte"
So wusste Safiatou während ihrer ganzen Behandlung nicht, an welcher Krankheit sie litt. "Der Gedanke ist mir überhaupt nicht gekommen", erzählt sie. "Ich wusste nur, dass ich hier wieder lebend hinaus wollte. Wenn ich gewusst hätte, dass ich mich mit einer Krankheit infiziert habe, für die es weder eine Behandlung noch eine Impfung gibt und die Mehrheit der Erkrankten stirbt – ich weiss nicht, ob ich überlebt hätte."
Über einer Woche lang hatte sie starken Durchfall und musste sich immer wieder übergeben. "Ich weiss nicht, wieviel Liter Wasser das Pflegepersonal in meine Adern gepumpt hat, damit ich nicht völlig dehydriere", fährt Safiatou fort.
Insgesamt blieb sie 13 Tage im Behandlungszentrum. Das erste Mal, als sie mit eigenen Augen sah, wie ein Kranker starb, war sie wie gelähmt. "Aber nach einigen Tagen hatte ich mich daran gewöhnt. Ich sagte mir, dass nur Gott entscheiden könne, wann meine Stunde gekommen wäre." Und Mohammed ergänzt: "I ch habe ihnen verboten, die Toten zu beweinen, solange wir nicht draußen waren. Schließlich mussten wir uns irgendwie die Hoffnung auf's Weiterleben bewahren."
Gerüchte und Beschimpfungen
Mohammed wurde als Erster geheilt entlassen, dann Safiatou und einige Tage später Mohammeds Frau. Die drei anderen infizierten Familienmitglieder haben die Krankheit nicht überlebt.
Wider Erwarten war die Entlassung für Safiatou sehr schwierig. "Es schmerzte, als mir meine Mutter sagte, wir da drinnen hätten es gut gehabt. Wir hätten wenigstens nicht unter den Gerüchten und Beschimpfungen leiden müssen, denen die von Ebola betroffenen Familien ausgesetzt sind."
Eines Abends forschte Safiatou nach, was das eigentlich für eine Krankheit ist. "Ich bin zusammengebrochen. Ich weinte die ganze Nacht und hatte Angst, dass ich jemanden anstecken könnte. Um zwei Uhr nachts rief ich Lucie an, eine der internationalen Pflegefachfrauen. Ich bat sie, mich sofort wieder in die Isolierstation zu bringen." Lucie konnte sie jedoch beruhigen und erklärte Safiatou, dass sie nicht mehr ansteckend sei, für niemanden, und dass die Menschen, die sie zurückwiesen, das nur nicht wüssten.
"Es ist schließlich meine Bürgerpflicht, den Erkrankten Hoffnung zu geben"
Als Safiatou im Mai von Ärzte ohne Grenzen angefragt wurde, ob sie mit den Teams zusammenarbeiten könne, sagte sie sofort zu. Seitdem durchquert sie jeden Tag die Schranke zur Isolierstation und besucht die PatientInnen auf der anderen Seite. Auch wenn Geheilte als immun gegen das Virus gelten, halten auch sie alle Vorsichtsmassnahmen ein, vor allem um zu vermeiden, dass sie sich bei den Verdachtsfällen mit anderen Krankheiten anstecken. "Am Anfang war es sehr hart. Ich sah, was wir selbst durchgemacht hatten und spürte die ganze Verzweiflung wieder aufsteigen", erzählt sie mit einem schwachen Lächeln. Dann hebt sie den Blick und sagt: "Aber ich habe mich aufgerafft und weitergemacht. Es ist schliesslich meine Bürgerpflicht, den anderen Erkrankten Hoffnung zu geben."
Die PatientInnen schauen sie mit großen Augen an, wenn sie erzählt, dass sie einige Monate zuvor noch selber so dagelegen hat. "Manchmal", erzählt sie, "glauben sie mir nicht sofort. Aber dann schenken sie mir Vertrauen, weil sie wissen, dass ich ihre Situation verstehe. Und dann kann ich ihnen Mut machen."
Trauzeugin nach der Genesung
Im Rahmen der Aufklärungsarbeit ist es Safiatous Aufgabe, die PatientInnen moralisch zu unterstützen, die Angehörigen zu beruhigen und der Bevölkerung zu erklären, wie man die Krankheit am besten vorbeugen kann. "Heute fühle ich mich richtig wohl und mache diese Arbeit sehr gern, vor allem, wenn ich einen Erkrankten davon überzeugen kann, zu essen und die Medikamente regelmäßig einzunehmen." Als sie gestern aus der Isolierstation kam, war sie völlig erschöpft und verschwitzt, aber glücklich. Eine junge Frau, die mehrere Tage nichts zu sich genommen hatte, aß ihren Teller leer, nachdem Safiatou sie angefragt hatte, nach ihrer Heilung und Entlassung als Trauzeugin bei Safiatous Hochzeit dabei zu sein.
Trotz allem hat Safiatou darum gebeten, nicht mit ihrem richtigen Namen erwähnt zu werden, aus Angst vor Stigmatisierung. Es gibt zwar Überlebende in Conakry, aber sie müssen weiterhin unsichtbar bleiben.
* Name geändert