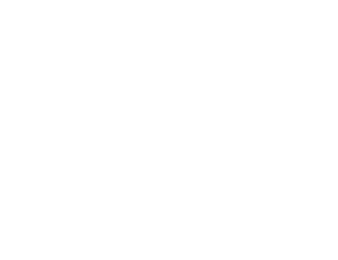Unsere medizinische Koordinatorin Ana berichtet von Geschichten der Überlebenden von Zyklon Idai und von den Erinnerungen an die Verlorenen.
Nichts symbolisiert die Zerstörung durch den Zyklon Idai in Mosambik so sehr wie die Bäume. Gefallen, gebrochen, blattlos zeugen sie von den schnellen Winden und reißenden Wassermassen, die selbst mächtige, jahrhundertealte Pflanzen leblos zu Boden fallen ließen.
Auf einmal dienten Bäume sogar als Rettungsflöße. Die Menschen in ländlichen und städtischen Gebieten suchten Zuflucht in ihren Zweigen, als das Wasser über ihre Dächer stieg und sie auf Rettung wartete, die manchmal nie kam. Nachdem sie verzweifelt durch die neu entstandenen Flüsse geschwommen waren, in denen einst Häuser und Farmen standen, erzählten mir die Betroffenen enttäuscht, dass das Überleben nichts mit der Güte oder dem Mut eines Menschen zu tun hat, sondern reiner Zufall ist und davon abhing, ob ein Ast da war, an dem man sich festhalten konnte.

Ein Leben, das vom Regen begraben wurde
Nicht nur die Bäume, sondern auch andere kleine Details erzählen weitere Geschichten. Der stagnierende, überflutete Teich in der Nähe von Lamego erinnert an die Mütter, die ihre Kinder gerügt haben, weil sie die Schule geschwänzt hatten, um im Fluss zu schwimmen. Am Ende sind sie dort selbst ertrunken wohingegen ihre Kinder überlebten, weil sie durch die heimliche Übung zu guten Schwimmern wurden, jedoch zu schwach waren, um ihre Eltern zu retten.
Ich bin irritiert, dass Menschen in einem Meer aus Schlamm, das zu einem Teil der ländlichen Gebiete wurde, im Kreis herumlaufen und dabei auf den Boden blicken. Ich begreife es erst, als sich jemand hinsetzt, um etwas für ihn Wesentliches zu entdecken, was für meine Augen unsichtbar ist: Müde Hände graben Familienportraits aus, ein T-Shirt, den Lieblingsspiegel. Alles Erinnerung eines Lebens, das vom Regen begraben wurde.
Feierliche Würde
Auf dem Weg zum Gesundheitszentrum von Nhampoca halten mich zwei ältere Männer an: „Kann der Arzt kommen und sich mit uns etwas anschauen?“ Ich nehme meine medizinischen Hilfsmittel aus dem Rucksack, bereit, einen Patienten in Not zu sehen. Doch als ich das Flussbett erreiche, bin treffe ich eine Gruppe von Männern, die sich feierlich um etwas oder jemanden versammelt haben und mir die Sicht versperren. Als ich sie vorsichtig zur Seite schiebe, sehe ich im Schlamm einzelne Details, die eine Geschichte erzählen. Das einst farbenfrohe Kleid einer Frau, das jetzt bräunlich und trist aussieht; ihre schlaffen Hände, die durch das Sumpfwasser verfärbt sind. "Ich bin zu spät, wir sind zu spät, es tut mir leid, ich kann nicht helfen", platzte es aus mir heraus. Sie nicken schweigend. Sie wollen ihr die letzte Ehre erweisen, gesehen zu werden. Ich sage, ich werde den Leuten davon erzählen, auch wenn ich nicht weiß, was ich damit meine. Ich werde es anderen erzählen.”

Anfällig für Malaria
Im kleinen ländlichen Dorf Nhatiquiriqui stellen sich die Menschen für die mobile Klinik von Ärzte ohne Grenzen an. Während der Gesundheitspromoter die Patientinnen und Patienten zu unserem kleinen medizinischen Bereich bringt – wir sitzen auf leeren Reissäcken, da niemand mehr Stühle hat – werden die Patientinnen und Patienten nach und nach mit Malaria diagnostiziert. Mehr als die Hälfte von ihnen sind Kinder unter fünf Jahren. Die Überschwemmungen zerstörten nicht nur ihre Häuser, sie nahmen den Menschen ihre Habseligkeiten – Moskitonetze, Kleidung – und machte sie noch anfälliger für die Stiche der Moskitos, die sich in den neu entstandenen Hochwasserseen frei vermehren können. Ein neunjähriges Mädchen, das viel älter aussieht als es ist, sitzt mit ihren beiden jüngeren Brüdern neben mir. Alle drei haben Malaria. Ich frage nach ihrer Mutter, um ihr den Behandlungsverlauf und die Präventivmaßnahmen für die Kinder zu erklären. Der Gesundheitspromoter berührt sanft meinen Arm und sagt, dass es keine Mutter mehr gibt. „Es gibt noch mehr davon", sagt er. Das Dorf wird Zeit brauchen, um sich von den Schicksalsschlägen zu erholen.
Erlösung
Die Phase der Nothilfe mag vorüber sein, aber wenn sich das Wasser zurückzieht, erzählen die Bäume weiterhin Geschichten. „Dort habe ich mich vier Tage lang festgehalten", sagt ein älterer Mann in Nhampoca. "Dieser Baum hat das Leben meiner Familie gerettet.“ Chipendo, ein Krankenpfleger im örtlichen Gesundheitszentrum, wurde nicht mithilfe eines ausgefallenen Hubschraubereinsatz gerettet, sondern durch den Mut der einheimischen Fischer, die einen Baumstamm zu einem improvisierten Kanu umfunktionierten und ihm - nach zwei Tagen ohne Essen und an einen Baum geklammert - zur Hilfe kamen und ihr eigenes Leben in der starken Strömung riskierten. Er bat darum, nicht nach Hause, sondern direkt ins Gesundheitszentrum gebracht zu werden. Dort gab es viel Arbeit zu erledigen und Patientinnen und Patienten zu behandeln.

Im dunklen Wasser
Am Ende waren es das Land und sein Volk, die litten, verloren waren, getröstet und wiederaufgebaut wurden. Während die Saat in Nhampoca wieder beginnt, schüchtern aus dem Boden zu sprießen, denke ich an all die Geschichten über Mut, Stärke, Widerstandsfähigkeit und Selbstlosigkeit, die ich seit dem Zyklon von den Überlebenden gehört habe, aber auch an die Erinnerung an diejenigen, die den Kampf um ihr Leben verloren haben. In diesem verwundbaren und fragilen Moment der Erholung beginnen die Mosambikanerinnen und Mosambikaner ihre Leben wiederaufzubauen. Ich gehe auf einem Feldweg, der vom Gesundheitszentrum zurückkommt, und werfe einen letzten Blick auf das stagnierende Hochwasser, wo bereits die ersten großen Wasserpflanzen zu wachsen beginnen, und zum ersten Mal sehe ich im dunklen Wasser Blumen.